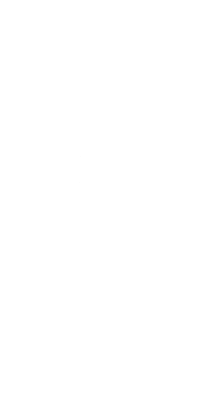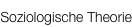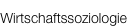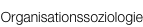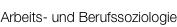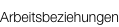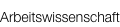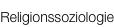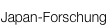Sozialstrukturforschung als Handlungsfeld-Analyse
Im Mittelpunkt meiner Arbeiten zur Gesellschaftsanalyse steht die Bestimmung einer Sozialstruktur als Wirkungszusammenhang sozialer Handlungsfelder. Diese Konzeption wurde von mir allmählich, aber folgerichtig entwickelt und dann auch immer wieder angewendet. In einer ersten soziologischen Veröffentlichung aus dem Jahre 1954 wird zunächst der Terminus "Soziales Spannungsfeld" verwendet, noch ganz unter dem Einfluss einer interaktionistischen und gleichermassen - wenn auch kritisch - dem Strukturfunktionalismus verpflichteten Sichtweise. Eine grundlegende Arbeit von 1956 setzt sich schon eigenständiger mit dem soziologischen Strukturbegriff auseinander und begründet eine dynamisierte Betrachtungsweise, die zweifellos Parallelen zu dem später entwickelten Konzept der "Strukturierung" von Anthony Giddens zeigt. Die Habilitationsschrift von 1962 brachte dann eine Präzisierung des sozialen Feldbegriffs (vgl. hierzu auch die Darstellung von Harald Mey: Studien zur Anwendung des Feldbegriffs in den Sozialwissenschaften, München: Piper 1965, S. 191-195).
Ihm liegt das Erkenntnisinteresse zugrunde, "die Gegenwartsgesellschaft...zunächst dynamisch auf die gestaltenden Kräfte zu analysieren, die die Gesamtstruktur bestimmen. Die Prozessabläufe werden also nicht...a priori in ein soziales System eingeordnet, sondern als dessen oft unabhängig wirkende Grundlage betrachtet. Die feststellbaren Impulse müssen sodann in ihrer Bedeutung für die verschiedenen Sozialsektoren verfolgt werden" (Aufstiegsproblem, S. 12). Der jeweilige Sozialsektor wird als "soziales Feld" charakterisiert, wodurch "an die Stelle eines Modells mechanistischer Kausalbeziehungen die Vorstellung eines Kontinuums von Wechselwirkungen" gesetzt wird (vgl. ebd. S. 53).
Allgemeiner und damit auch stärker vom Systembegriff abgesetzt wird dann 1966 in der Arbeit zur "Sozialstruktur als Schlüsselbegriff der Gesellschaftsanalyse" das Konzept des "Handlungsfeldes" herrausgearbeitet und als wesentlicher Bestandteil einer Sozialstrukturanalyse dargestellt. Ihr Ziel soll es sein, Aussagen über die Wirkungsweise der sozialen Felder in einer Gesellschaft zu machen, wodurch sich die Grundposition wesentlich von solchen Analysen unterscheidet, in deren Mittelpunkt die quantitative Ermittlung von Soziallagen durch Datenmodellierung steht. Es geht also z.B. bei der Frage nach Strukturen der sozialen Ungleichheit nicht nur um den Verteilungsmodus von Soziallagen, sondern auch um die Reproduktionsmuster sozialen Handelns. (Vgl. hierzu mein Buch: Soziale Handlungsfelder, Opladen: Leske + Budrich 1995).
Jede Sozialstruktur kann einen mehr oder weniger ausgeprägten Verfestigungsgrad im Sinne der Normbindung des Verhaltens haben. In den Handlungsfeldern nehmen Personen und Gruppen ebenfalls mehr oder weniger festgelegte Positionen ein, die eine situationsspezifische Soziallage mit entsprechenden Ressourcen kennzeichnet. Entsprechend den unterschiedlichen Soziallagen bilden sich Interessen zu deren Bewahrung oder Veränderung heraus, die das Handlungsfeld in ein soziales Spannungsfeld transformieren. Interessen können sich im Zusammenhang mit Bedürfnissen und sozialkulturellen Werten zu Orientierungsmustern entwickeln, die das Sozialbewusstsein der Handlungsträger nachhaltig prägen und die auch durch Sozialisationsprozesse überlieferungsfähig sind. In der gesellschaftlichen Praxis entwickeln sich durch Habitualisierung von entsprechenden Haltungen und Mentalitäten Identifizierungsmuster, die eine Typisierung der Handlungsträger ermöglichen (vgl. die Anwendung dieses Bezugsrahmens in meinem Buch: Berufsgesellschaft in der Krise. Berlin: edition sigma 2000).